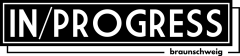Wie hältst du es mit dem Staat?
(aus: In/Press #0, Mai 2017)
Der Staat weckt unterschiedlichste Erwartungen: Er soll für soziale Gerechtigkeit, sichere Renten und ein gutes Gesundheitssystem sorgen, gegen Nazis vorgehen und die Finanzmärkte bändigen. Zugleich bekommen die Menschen aber auch täglich seine Gewalt zu spüren, sei es bei Demonstrationen, in der Schule oder auf Ämtern und Behörden. Nicht zuletzt anlässlich der Kämpfe zum 1. Mai und der Mobilisierung zu den G20-Protesten wird deutlich: Innerhalb der Linken gehen die Interpretationen über den Staat weit auseinander. Für die einen ist er Garant des Allgemeinwohls, anderen gilt er als das Instrument der kapitalistischen Klassenherrschaft und wieder andere sehen in ihm das Terrain sozialer Kämpfe.
Wie ist es also um das Verhältnis von Kapitalismus und Staatlichkeit bestellt und welche Ansatzpunkte für eine emanzipatorische Kritik und Praxis können ausgemacht werden? Da wir nicht die ersten sind, die sich aus linker Perspektive mit dieser Frage beschäftigen, wollen wir im Folgenden einen kleinen einführenden Überblick geben über die zentralen Stränge materialistischer, marxistischer Staatstheorie.
Staat der Kapitalisten oder integraler Staat?
Der Ausgangspunkt der Überlegungen des italienischen Marxisten Antonio Gramsci zu Staat und Politik in den 1920er Jahren ist die Revolutionsfrage: Warum kam es in Russland mit der Oktoberrevolution zu einem bolschewistischen Umsturz, während im westlichen Europa ähnliche Bemühungen scheiterten oder schon im Ansatz unterdrückt wurden? Gramscis Reflexion revolutionärer Politik ist dabei auch als Kritik an der zu seiner Zeit dominierenden Strömung des Marxismus zu verstehen, die den Staat vor allem als Machtinstrument der herrschenden Klasse verstand. Die Vorstellung, Politik und Staat auf bloße Überbau-Phänomene zu reduzieren, welche durch die wirtschaftliche Basis umfassend bestimmt sind, lehnte Gramsci als zu ökonomistisch, deterministisch (vorbestimmt) und unterkomplex für die Staaten Westeuropas ab, da diese im Gegensatz zum zaristischen Russland kein zentralisiertes Machtzentrum hätten, das lediglich erobert werden müsste.
Dieser instrumentalistischen Staatskonzeption im Sinne Lenins stellt Gramsci die Idee eines erweiterten, integralen Staates gegenüber, der nicht auf ein engeres Verständnis von Regierungsapparat, Parlament und Rechtsprechung zu reduzieren ist. Vielmehr sei der Staat eine Einheit aus eben jener politischen Gesellschaft und der zivilen Gesellschaft, was schließlich in seiner berühmten Formel von bürgerlich-kapitalistischer Staatsmacht als „Hegemonie, gepanzert mit Zwang“ mündet. Die Zivilgesellschaft versteht Gramsci als den Ort, in dem um gesellschaftliche Hegemonie gerungen und sie gleichzeitig ausgeübt wird. Hegemonie bedeutet nach Gramsci vor allem Herrschaftsausübung mit dem Ziel der konsensualen Einbindung der Regierten, also durch die Zustimmung der Subalternen (Untergeordneten) zur eigenen gesellschaftlichen Stellung bzw. die Anerkennung der herrschenden Interessen als Allgemeininteressen. Institutionen der Zivilgesellschaft können demnach Schulen und Kirchen ebenso bilden, wie Medien und Vereine. Sein Staatsverständnis schließt also neben der klassischen Ausübung von Herrschaft durch Zwang in der politischen Sphäre auch jene Vermittlung durch Hegemonie mit dem Ziel aktiver Zustimmung der Regierten selbst in der gesellschaftlichen Sphäre ein, die für die Stabilität und Reproduktion der Klassenverhältnisse unabdingbar ist.
Ideologische Staatsapparate & die Verdichtung von Kräfteverhältnissen
Als einer der ersten bezog sich der französische Marxist Louis Althusser in den 1970er Jahren wieder auf Gramscis Ideen und dessen Staatsverständnis. Die Problemstellung war bei Althusser dann auch eine ganz ähnliche: Zum einen blickte er auf die gescheiterte Revolte der französischen StudentInnenbewegung im Mai 1968 zurück, zum anderen zeigten sich in den realsozialistisch regierten Ländern weltweit keine Anzeichen von einem Absterben des Staates.
Althusser machte den Begriff der Staatsapparate zum zentralen Punkt seiner Konzeptionen. Darin teilt er die Einschätzung Gramscis, dass der Staat nicht auf den Bereich der klassischen, repressiven Herrschaft zu beschränken ist sondern ebenso ideologische Staatsapparate von Nöten sind. Althusser legt dar, dass die Arbeitskraft im Kapitalismus sowohl in unmittelbarer Form (Schlaf, Essen, Wohnung) als aber auch ideologisch reproduziert werden muss. Die ideologischen Staatsapparate (Schule, Religion, Familie, Medien, Kultur) ermöglichen die Unterordnung und Zustimmung zu der herrschenden Ideologie durch die Anrufung des Individuums als freies Subjekt, garantiert durch den bürgerlich-kapitalistischen Rechtsstaat. Althusser versucht somit den Zusammenhang und die Wirkungsweise staatlicher und gesellschaftlicher Herrschaftsmechanismen zu präzisieren und darzulegen, dass die Überbauten des Staats und der Ideologie für die Reproduktion der Klassenverhältnisse nicht von zweitrangiger Bedeutung, sondern wesentlich für gesellschaftlichen Konsens und die Stabilität der kapitalistischen Gesellschaftsordnung sind.
Genau an diesem Punkt setzte wenige Jahre später ein ehemaliger Schüler Althussers, der französisch-griechische Staatstheoretiker Nicos Poulantzas, an.
Poulantzas programmatische Frage lautete: „Warum greift die Bourgeoisie im Allgemeinen in ihrer Herrschaft auf diesen nationalen Volksstaat zurück, diesen modernen Repräsentativstaat mit seinen spezifischen Institutionen, und nicht auf einen anderen? Denn es ist keineswegs selbstverständlich, dass sie sich genau diesen aussuchen würde, wenn sie den Staat komplett selbst und nach ihrem Geschmack aufbauen könnte.“ (Poulantzas 2002: 40)
Poulantzas zufolge stellt der Staat die Form dar, in der sich die bürgerliche Klasse als herrschende organisiert und überhaupt erst begründen kann. Dies geschehe jedoch keineswegs einheitlich oder konfliktfrei; vielmehr kämpfen verschiedene Kapitalfraktionen um die Deutungs- und Steuerungshoheit zur Durchsetzung ihrer Interessen als allgemeine Interessen. In diesem Verständnis dient der Staat sowohl zur Organisation und Vermittlung von Hegemonie innerhalb der herrschenden Klasse als auch gegenüber der beherrschten Klasse.
Demnach muss der kapitalistische Staat als ein Verhältnis begriffen werden, als ein spezifischer Ausdruck der „materiellen Verdichtung eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen“. Der Staat kann als Knotenpunkt gedacht werden, in dem sich gesellschaftliche Widersprüche konzentrieren und in dem besondere Klassenkompromisse hergestellt werden. Poulantzas‘ Idee der Verdichtung sozialer Kräfteverhältnisse ermöglicht darüber hinaus nicht nur die ökonomischen Klassenverhältnisse als bestimmend zu erfassen sondern ebenso weitere Machtbeziehungen, wie beispielsweise die Geschlechterverhältnisse, welche in den Staatstheorien häufig ignoriert werden, in die Analyse miteinzubeziehen.
Der Staat des Kapitals als Ausdruck der Warenform
Parallel zur französischen, durch Althusser und Poulantzas‘ geprägten Theorieentwicklung, entstand vornehmlich im bundesrepublikanischen Deutschland die sogenannte Staatsableitungsdebatte im Rahmen der „Neuen Marx-Lektüre“. Dabei ging es um die Beantwortung der Frage, die in den 1920er Jahren bereits der Rechtsphilosoph Jewgeni B. Paschukanis aufwarf: „[W]arum bleibt die Klassenherrschaft nicht das, was sie ist, das heißt die faktische Unterwerfung eines Teils der Bevölkerung unter die andere? Warum nimmt sie die Form einer offiziellen staatlichen Herrschaft an, oder – was dasselbe ist – warum wird der Apparat des staatlichen Zwangs nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen, warum spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersönlichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an?“ (Paschukanis 2003, S. 139)
Paschukanis untersuchte, wie sich die Rechts- und Staatsform innerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse aus der Warenform ableitet. Demnach begegnen sich im Kontext kapitalistischer Produktionsverhältnisse Eigentümer*innen von Produktionsmitteln und Lohnarbeiter*innen als gleiche Privatrechtssubjekte und erkennen sich als solche an, was einen Wechsel von personaler Herrschaft hin zu einer getrennten, abstrakt-allgemeinen Herrschaftsform nach sich zieht. Die dafür grundlegende formale Freiheit und Gleichheit der Individuen als Bürger*innen eines Nationalstaats werden dabei vom Staat durch das Gewaltmonopol hergestellt und garantiert.
Diese Überlegungen dienten als Grundlage für die Ansätze der Staatsformanalyse fünf Jahrzehnte später. Die politischen Rahmenbedingungen waren geprägt durch die erste sozialliberale Koalition Deutschlands, die innerhalb der Bevölkerung große Hoffnungen auf gesellschaftliche Reformen weckte. Kritik- und Ausgangspunkt der Debatte war daran anschließend der Vorwurf eines falschen, instrumentellen Staatsverständnisses in weiten Teilen der politischen Linken, die einer Sozialstaats- und Reformillusion nachhingen. Grundlage für diese Illusion bildet der Umstand, dass im Kapitalismus die ökonomische und die politische Sphäre relativ voneinander getrennt sind. Der Staat erscheint somit als neutrale Regelungsinstanz, die formal Rechtssicherheit und Freiheit garantiert und sich dadurch als Adressat politischer Forderung anbietet. Wenngleich der Staat somit keineswegs ein Instrument der Kapitalisten ist – er trifft, siehe Mindestlohn, sogar Entscheidungen, die dem Interesse einzelner Kapitalfraktionen entgegenstehen – so ist er doch Staat des Kapitals: Denn er sorgt dafür, dass dem Kapitalismus als ganzem nicht die Geschäftsgrundlage entzogen wird und sich die Faktoren Arbeit und Kapital gesellschaftlich reproduzieren (können). Zugleich erkennt der Staat damit jedoch auch die materiellen Ungleichheiten in der kapitalistischen Gesellschaft an.
Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre von Weltwirtschaftskrise bis zu den jüngsten Renationalisierungstendenzen machen deutlich: Die Frage nach dem Staat und seinem Verhältnis zu Ökonomie und Gesellschaft hat nicht an Bedeutung verloren. Linke, emanzipatorische Antworten in Form von Analysen und Protesten, wie am 1. Mai oder im Juli gegen die G20, sollten nicht hinter die grundsätzlichen Erkenntnisse materialistischer Staatstheorien zurückfallen. Ansonsten laufen sie Gefahr, sich im Reformismus zu verlieren oder die bloße Machtübernahme der Staatsgewalt anzustreben. Eine grundlegende Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse und die nachhaltige Überwindung des Kapitalismus dürften so nicht zu erreichen sein.
Zum Weiterlesen
- associazione delle talpe / Rosa Luxemburg Initiative Bremen (2009): Staatsfragen. Einführungen in die materialistische Staatskritik: www.rosalux.de/publikation/id/4321/