Seit vielen Jahren schauen Rechte nicht nur hierzulande mit Begeisterung darauf, wie die Regierung unter Viktor Orbán ohne große Widerworte aus der Europäischen Union die ungarische Gesellschaft umbaut.
(aus: In/Press #8, Juni 2020)
Während der COVID-19-Pandemie legen viele Staaten ein Krisenmanagement vor, welches die Bürger*innenrechte stark beschneidet. Die Notstandsmaßnahmen müssen jedoch zumeist auf das Notwendigste begrenzt werden und verhältnismäßig sein. Nicht so in Ungarn. Seitdem das ungarische Parlament Ende März das unbefristete Notstandsgesetz verabschiedet hat, werden die Rufe der EU gegen eine Orbán-Diktatur lauter.
Es scheint, als hätte der Ministerpräsident und Vorsitzende der FIDESZ-Partei unter dem Deckmantel der Pandemiebekämpfung die Machtstellung seiner nationalkonservativen Regierung weiter ausgebaut und die Demokratie nun gänzlich abgeschafft. Dabei wurden demokratische Grundprinzipien in Ungarn seit seinem Amtsantritt im Jahr 2010 bereits mehrfach ins Visier genommen.
Orbáns Regierung und seine Partei stehen seit Jahren wegen Korruption, der Einschränkung von Bürgerrechten, der Unabhängigkeit der Justiz sowie der Medien- und Meinungsfreiheit in der Kritik. Die Liste ist lang und reicht von der Kriminalisierung von Obdachlosigkeit bis hin zu einem Arbeitszeitgesetz, welches bis zu 400 Überstunden im Jahr erlaubt. Zudem erfolgten marktgerechte Privatisierungen von öffentlichen Einrichtungen, wie beispielsweise einer Budapester Universität im Jahre 2019. Beschlossen wurde ebenfalls, dass das Fach „Gender Studies“ abgeschafft wird, denn es untergrabe die Fundamente der christlichen Familie. Auch soll der Lehrplan in Schulen zeitnah auf einen fest vorgegebenen „Nationalen Grundlehrplan (NAT)“ umgestellt werden. Geschichtsrevisionismus sowie völkisch-antisemitische Werke werden somit Pflichtlektüre. Gleichschaltung im Namen der Nation sozusagen.
Alles unter Kontrolle
Durch das Notstandsgesetz darf Orbán von unbegrenzter Dauer per Dekret regieren. Dies beinhaltet unter anderem, bestimmte Gesetze aussetzen zu können und „andere außergewöhnliche Maßnahmen durchzuführen, um die Stabilität des Lebens, der Gesundheit, der persönlichen und materiellen Sicherheit der Bürger wie der Wirtschaft zu garantieren“. Eine Klausel im Gesetz sieht die Möglichkeit einer „erzwungenen parlamentarischen Pause“ vor. Aktuell tagt das Parlament weiter, kann das Handeln des Ministerpräsidenten jedoch nur zur Kenntnis nehmen. Ergänzend dazu dürfen bis zum Ende des Notstandes auch keine Wahlen stattfinden. Die angesetzten Parlamentswahlen im Jahre 2022 laufen nun Gefahr abgesagt zu werden.
„Die Zeit der Debatten ist vorbei“ sagte Orbán in seiner Rede während seiner Kampagne zur Parlamentswahl im Jahr 2018. Es ist eindeutig, dass der einstige Liberale keine Kritik an seiner Politik oder Autonomie im eigenen Land akzeptiert. Die Pressefreiheit in Ungarn wurde durch die Umstrukturierung der Medienlandschaft vollkommen verändert und unter staatliche Führung der „Közép Európai Sajtó és Média Alapítvány“ (Mitteleuropäische Stiftung für Medien und Presse) gestellt. Andere unabhängige Pressehäuser wurden kurzer Hand geschlossen, um regierungskritische Journalist*innen mundtot zu machen. Somit kam das neue Verbot des Verbreitens von „Falschnachrichten“, „Panikmache“ und der Darstellung von „wahren Tatsachen in verzerrender Weise“ in Zusammenhang mit der Corona-Krise nicht überraschend. Den letzten liberalen Plattformen droht durch die Änderung das Aus oder sogar erhebliche Haftstrafen.
Nach zehn Jahren harter Arbeit sei wirtschaftlich durch Corona „jetzt alles bedroht, wofür wir gearbeitet haben“ klagte Orbán in einer seiner Pressekonferenzen zu COVID-19. Um Arbeitsplätze zu erhalten, will die Regierung nun einen Teil der Löhne für jene Angestellten übernehmen, die in Kurzarbeit gehen müssen. Umgerechnet 1,2 Milliarden Euro sollen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen fließen. Weitere 5,5 Milliarden Euro will die Regierung aufwenden, um Unternehmen Kredite sowie staatliche Garantien zu geben. Zudem werden Polizei und Armee in den Dienst von systemrelevanten Wirtschaftsunternehmen gestellt. Soll heißen, dass Betrieb und Produktion aufrechterhalten und koordiniert werden können. Auch wenn als Folge der Krise eine Pleite drohe, Arbeiter*innen entlassen werden müssten oder Unterbrechungen in Lieferketten bevorstehen. Dazu zählen Konzerne, die ohnehin unter staatlicher Kontrolle stehen. Unter der Aufsicht stehen ebenfalls private und internationale Großunternehmen. Ebenso werden die Profitinteressen deutscher Automobilhersteller oder der Firma Bosch verteidigt. Deutschland ist nach realwirtschaftlichen Zahlen nämlich der größte Investor in der ungarischen Ökonomie.
„Nekünk Magyarország az első“ – „Für uns kommt Ungarn an erster Stelle“
Orbán merkte zu spät, wie wichtig es ist, die Pandemie ernst zu nehmen und entsprechende gesundheitspolitische Maßnahmen zu ergreifen. Rechtzeitig erkannte er jedoch die Situation als eine Chance, um seinen Machtanspruch im Land weiter auszubauen. Dabei gehören allen voran Verschwörungskonzepte zu seiner ideologisch-politischen Agenda. 2017 startete die Regierung eine Kampagne gegen den aus Ungarn stammenden, jüdischen Investor George Soros. Der als „Staatsfeind“ bezeichnete US-Milliardär wird bezichtigt, die Migration aus dem Mittleren Osten mithilfe von Brüssel zu fördern, um den kulturellen Hintergrund Europas zu ändern. Zuletzt bezeichnete Orbán das Corona-Virus ebenfalls als Verschwörung und reine Panikmache der liberalen Politiker*innen Europas. Solche Phrasen und Ansichten werden durch regierungsnahe Politiker*innen und Medien verbreitet, um die Ängste der Bürger*innen zu schüren und zu beweisen, dass die ungarische Regierung das Land gegen äußere Bedrohungen und Feinde schützen müsse.
Dabei ist bekannt, dass ungarische Regierungen Krisen schon in der Vergangenheit für die Verabschiedung unbefristeter Notstandsgesetze nutzten. Beispielhaft dafür steht die Migrationspolitik Ungarns im Jahre 2015. Bis heute ist noch der Ausnahmezustand in Kraft, der während der „Migrationskrise“ ausgerufen wurde. Dieser wurde 2016 vom ungarischen Innenministerium ohne Begründung auf 10 Jahre verlängert. Mit diesen vagen Verordnungen erlaubte Orbán dem Militär, die Grenzen zu kontrollieren und Geflüchtete hart zu bekämpfen. Und das, obwohl seit 2015 ein Grenzzaun an der serbisch-ungarischen Grenze gebaut wurde und die Asylanträge aufgrund von Reglementierungen auf knapp 500 Stück pro Jahr sanken. Die Übergänge an der serbischen Grenze sind seit dem 3. März 2020 geschlossen. Trotz dessen stellen die Politiker*innen die illegale Migration noch als größtes Problem dar. Die Regierung wirft Migrant*innen vor, das Coronavirus nach Ungarn gebracht zu haben, da die ersten Fälle unter iranischen Studierenden in Budapest entdeckt wurden. Unabhängig davon, dass diese ganz „legal“ in dem Land studieren. Regierungsmedien zufolge sitzen derzeit 11 iranische Student*innen in Haft, da diese die Zusammenarbeit mit den Behörden verweigerten und gegen die Bedingungen unter Quarantäne im Krankenhaus protestierten. Sie sollen zeitnah abgeschoben werden.
Der Ausnahmezustand lernt laufen
Die Corona-Krise trifft Minderheiten besonders hart. Seit dem 30. März wurden in Ungarn in Folge des Ausnahmezustandes diverse Maßnahmen beschlossen und Gesetzesvorlagen ausgearbeitet, die ihre Lebensrealitäten nun zu verschlimmern drohen. Ein Schlag ins Gesicht für Trans- und Inter-Personen ist der Gesetzesentwurf, der es unmöglich machen würde, sein Geschlecht zu ändern. Der Eintrag im Personenstandsregister würde durch „Geschlecht bei Geburt“ ausgetauscht. Auch der Vorname könnte nachträglich nicht mehr geändert werden. Inzwischen wurde das Gesetz von der Regierung beschlossen.
Ferner beschloss das ungarische Parlament schon, dass fortan nicht nur der Geburtsort auf den Personalausweisen ausgewiesen, sondern auch der „Abstammungsort“ auf dem Ausweis vermerkt werden muss. Ein Schelm, wer dahinter völkisch-nationale Absichten wie Ausgrenzung nicht ins Schema passender Menschen vermutet.
Schwache oder marginalisierte Menschen sind besonderer Stigmatisierung ausgesetzt. Im Zuge der Pandemie werden die Eingangstüren von Wohnungen, in denen sich den Behörden bekannte Infektionsverdächtige oder Coronavirus-Erkrankte aufhalten, mit für alle deutlich sichtbaren roten Aufklebern gekennzeichnet. Die arme Bevölkerung in den ländlichen Gebieten des Nordostens konnte sich vor der Krise schon keine Lebensmittel leisten. Ihr kommen verschwindend geringe finanzielle Unterstützungen des Staates zu, da die Hilfsprogramme stetig gekürzt werden.
Antiziganistische werden gegenwärtig genutzt, um die rassistischen Positionen als Regierungshandeln zu legitimieren und umzusetzen: Neben den allgemeinen Beschränkungen werden zusätzliche Maßnahmen für Rom*nija-Siedlungen ergriffen – diese werden präventiv unter Quarantäne gestellt oder polizeilich abgeriegelt.
Im Zeichen des „Kampfes gegen das Virus“ werden nun alle Patient*innen und chronisch Kranken, auch die, die weiterhin ausführlicher Pflege bedürfen, aus den Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen zwangsentlassen. Der Personalminister Miklós Kásler hat in diesem Zusammenhang zwei Krankenhausdirektoren entlassen, die sich weigerten, der Ministerialverordnung zur sofortigen Entlassung der Patient*innen Folge zu leisten. Die Zwangsentlassungen haben ihren Ursprung in einem Orbán-Dekret vom 10. April, laut dem mindestens 60% aller Krankenhausbetten in Ungarn für Coronavirus-Patient*innen zur Verfügung stehen müssen. Dies bedeutete die „Leerung“ von knapp 36.000 Krankenhausbetten im gesamten Land. Die Corona-Krise trifft in Ungarn ohnehin auf einen Gesundheitssektor, der bereits vor dem Ausbruch der Pandemie dürftig ausgestattet und überlastet war. Das unterfinanzierte Gesundheitssystem weist einen erheblichen Kapazitäts- sowie Personalmangel auf. Viele Ärzt*innen wanderten aufgrund von geringer Bezahlungen und katastrophalen Krankenhausbaumängeln ins umliegende Ausland aus.
Heuchlerischer Zwischenruf aus Brüssel
In den letzten zehn Jahren hat die Regierungspartei FIDESZ die meisten demokratischen und rechtsstaatlichen Kontrollen, die ihre Machtausübung beschränken, entweder abgeschafft oder auf eine Linie gebracht. Auf dem Papier befindet sich Ungarn jedoch weiterhin im rechtlichen und politischen Rahmen der Europäischen Union. Ein schwacher Trost ist das laufende Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Ungarn. Das im Jahre 2018 vom EU-Parlament eingeleitete Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags soll die ungarische Regierung dazu bewegen, den Schutz von Minderheiten sowie Geflüchteten, Meinungs- und Pressefreiheit als auch die Unabhängigkeit der Justiz zu gewährleisten. Ob es zu ernsthaften Konsequenzen kommt, ist aber weiterhin unklar. Allen voran aus dem Grund, dass Politiker*innen aus Ost- und Mitteleuropa dem Strafverfahren kritisch gegenüberstehen. Außerdem müssten bei einem entsprechendem Votum 22 der 28 Staaten zustimmen.
Innenpolitisch kann Orbán diesen Konfrontationskurs der EU für sich instrumentalisieren. Je mehr Gegenwind aus Brüssel weht, desto mehr Unterstützung erfährt er von loyalen Anhänger*innen aus seinen eigenen Reihen. Jeder noch so kleine Protest aus der Europäischen Union würde aus Sicht der Anhänger*innen nur die kruden Verschwörungskonzepte, die Orbán in den letzten Jahren in Anti-EU-Kampagnen verpackte, bestätigen.
Die jüngste Empörung von Ursula von der Leyen bei einer Konferenz zur Corona-Krise Anfang April wirkt wie ein weiteres Lippenbekenntnis, wenn man bedenkt, dass das Land diesen illiberalen Kurs seit mehreren Jahren fährt. Die EU hat all diese Maßnahmen gesehen, geduldet und größtenteils auch finanziert. Denn es gab mehrere Anhaltspunkte, die schärferer Kritik oder Maßnahmen bedürft hätten. EU-Gelder wurden für die Finanzierung von Prestigebauprojekten genutzt oder flossen treuen Unterstützer*innen Orbáns zu. Der geringe Protest aus Brüssel gegen Orbáns aktuellen Ausbau seiner Alleinherrschaft lässt sich möglicherweise auch durch das Abstimmungsverhalten Ungarns bei von der Leyens Wahl zur Kommissionspräsidentin erklären. Sie bekam die meisten Stimmen von polnischen und ungarischen Politiker*innen.
Zudem ist Ungarn ein lukrativer Standort für deutsche Investoren. Im Land herrschen niedrige Arbeitskosten, die gewerkschaftliche Organisierung in den Betrieben ist vergleichsweise gering und der Staat subventioniert die Produktionsstätten, indem die Unternehmen einen geringeren Steuersatz zahlen müssen. Auf diese Weise profitieren beide nationalen Ökonomien von einer guten Beziehung.
Neben der EU gibt es aber auch von anderen Seiten kaum Widerspruch. Der geringe Protest aus Deutschland gegen den Abbau der Demokratie erklärt sich auch durch wirtschaftliche Interessen.
Krisengewinner Orbán
Eventuell ist es auch ein vorschnell gefälltes Urteil, die Gesundheitskrise als fadenscheinigen Vorwand Orbáns zu nennen, um seine Machtkonzentration zu zementieren. Er ist der beliebteste Politiker im Land, seine Regierungspartei besitzt eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und laut aktuellen Umfragen des Meinungsforschungsinstituts „Nézőpont“ sind 78% der ungarischen Bürger*innen zufrieden mit der Regierungspolitik seit Beginn des Notstandes.
Jedoch steht das Institut ebenfalls unter der Leitung von FIDESZ. Somit ist das Stimmungsbild in der Bevölkerung schwer nachzuvollziehen.
Die zumindest vermeintlich steigende Beliebtheit während der Krise ließe sich durch ein wahltechnisches Manöver erklären. Dem Gesetzentwurf zum Ausnahmezustand wurde bewusst keine zeitliche Begrenzung hinzugefügt. Aufgrund dieser fehlenden zeitlichen Befristung stimmte die Opposition im Parlament gegen den Entwurf. Die regierungsnahe Presse nahm dies zum Anlass, die Behauptung aufzustellen, dass die Opposition im Kampf gegen das Corona-Virus nicht mitziehe und somit Ungarnverräter sei.
Schwere Zeiten also für politische Gegner*innen der Regierung. Dabei hatten im vergangenen Jahr die Kandidat*innen der Oppositionsparteien die Kommunalwahlen in Großstädten wie Pécs und Budapest deutlich gewonnen.
Auf diese positive Entwicklung folgte nun ein erneuter Coup von Orbáns Regierung: Gelder, die für die kommunalen Verwaltungen bestimmt waren, wurden umgelenkt und fließen nun in den Topf für die Aufgaben zur Bekämpfung der aktuellen Krise. Mit den fehlenden 1354 Milliarden Forint (umgerechnet knapp 4 Milliarden Euro) verfügen die Kommunen über zu wenig Ressourcen, um ihre Politik vor Ort umzusetzen. Perspektivisch führt dies zu einem sinkenden Vertrauen der Wähler*innen in die Handlungsfähigkeit der Oppositionsparteien und somit zu einem Stimmenanstieg für die FIDESZ-Partei.
Zwar gibt es in der ungarischen Zivilgesellschaft auch linke und progressive Stimmen, die in der Vergangenheit gegen verschiedenste Regelungen und Missstände auf die Straße gingen – jedoch werden der Aktionsradius ihres Widerstandes immer weiter eingeschränkt und ihre Tätigkeiten zunehmend kriminalisiert. Diese Gegenstimmen benötigen dringlichst Unterstützung und Solidaritätsbekundungen aus dem Ausland, die auf die autoritären ungarischen Zustände hinweisen.
Die antidemokratische Umgestaltung Ungarns wird weitergehen, denn Orbán wird auch perspektivisch die Grenzen seiner Scheindemokratie weiter in Richtung eines autoritären, diktatorischen Systems verschieben. Zeitgleich entblößen die anderen EU-Staaten mit fortlaufender Untätigkeit ihre eigenen reaktionären Tendenzen. Zwar ist Viktor Orbáns FIDESZ-Partei ist seit etwa einem Jahr aus der konservativen Europäischen Volkspartei suspendiert. Bei der Abstimmung zum Ausschluss jedoch fehlte damals die Mehrheit. Auch deshalb, weil die CDU/CSU die Forderung nicht mittrugen.
Es bleibt zu hoffen, dass es zukünftig andere Sanktionen und ein stärkeres Vorgehen gegen die ungarische Regierung geben wird. Das Einzige, was Orbán zum Nachdenken bringen könnte, wäre eine Kürzung der finanziellen Mittel aus Brüssel. Denn bisher scheint es Ungarn nicht geschadet zu haben, lediglich verbalen Druck aus der EU zu erfahren.
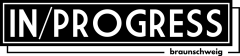

Ein Gedanke zu „Ungarische Diktatur unter Quarantäne“
Kommentare sind geschlossen.